Ich war erstaunt, als ich einige Jahre nach meinem Studium beim Finanzamt im Zuge meines radverkehrspolitischen Engagements feststellen musste, dass die Regelungen zur Aufhebung von Verwaltungsakten (bei „uns“ hpts. Steuerbescheide) in der Abgabenordnung (§§ 172 ff.) wesentlich umfangreicher und großzügiger gestaltet sind, als jene im Verwaltungsverfahrensgesetz. Bei der Entfernung von Verkehrszeichen wird es dann noch einmal besonders absurd. Jedenfalls wird in Deutschland ganz allgemein die Bestandskraft von Verwaltungsakten höher gewichtet, als die Erklärung einer diesem Verwaltungsakt zugrundeliegenden Regelung für verfassungswidrig.
Als bspw. bereits vor mehreren Monaten auch die Verfassungsgerichtshöfe von Sachsen-Anhalt und Thüringen zwei Corona-Verordnungen aus überwiegend formellen Gründen für verfassungswidrig erklärten, fiel mir auf, dass auch im Bereich der alternativen Medien kein wirklicher Ruf nach Konsequenzen, wie die Rückzahlung von Bußgeldern (oder gar einer strafrechtlichen Verurteilung Söders Ramelows wegen Freiheitsberaubung und Nötigung) zu vernehmen war.
Dass es im Steuerrecht allgemein etwas „lockerer“ läuft, erläuterte ich unlängst bzgl. der damaligen Streichung der Pendlerpauschale für die ersten 20 Kilometer. Hier wurde von Seiten des Ministeriums zeitig die Vorläufigkeit erklärt, Widerspruchsverfahren ließ man ruhen – und das Bundesverfassungsgericht sein Urteil fällen. Was den Finanzämtern dann zwar trotzdem immer noch eine Menge Arbeit bescherte; wenn auch weniger, als wenn hunderttausende von Einsprüchen erhoben worden wären.
Im „normalen“ Verwaltungsverfahren ist so etwas jedoch grundsätzlich und auch im Ausnahmefall nicht in dieser Form vorgesehen. In den entsprechenden Paragraphen des Verwaltungsverfahrensgesetzes findet man auch keine mit dem § 165 AO vergleichbare „Vorläufigkeit“ – und damit auch keine Möglichkeit, Verfahren bspw. bis zu einer Grundsatz-Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts oder des Bundesverfassungsgerichts einfach ruhen zu lassen.
Im Verwaltungsverfahrensgesetz, welches auch für Bußgeldbescheide Anwendung findet, sind im Vergleich zur Abgabenordnung die Regelungen in den §§ 43 ff. eben wesentlich enger gefasst. Eine spätere Erklärung der zugrundeliegenden Regelung oder gar gesamten Verordnung für verfassungswidrig und nichtig (§ 44 VwVfG), führt grundsätzlich erst einmal nicht automatisch zum Durchbruch der Bestandskraft (die sich in aller Regel durch den Ablauf der ungenutzten Einspruchsfrist ergibt) der sich darauf stützenden Bußgeldbescheide. In § 48 (1) S. 1 heißt es:
Ein rechtswidriger Verwaltungsakt kann, auch nachdem er unanfechtbar geworden ist, ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft oder für die Vergangenheit zurückgenommen werden.
Kann! Nicht „muss“! Nach dem Urteil des Bayerischen VGH vom 04.10.21 zu den verhängten Ausgangssperren im Frühjahr stellt sich nun u. a. auch die Rechtsanwältin Jessica Hamed die Frage, ob die Regierung des „Freistaates“ Bayern von sich aus (wie in Spanien), nach Eintritt der Rechtskraft, alle Bußgelder zurückzahlen werde? Nun, genau genommen muss sie dies nicht einmal – und wenn, dann auch nur aufgrund eines begründeten (aber ablehnbaren) Antrages des jeweils Betroffenen. Die wesentliche Rechtsgrundlage wäre hierfür der § 51 (1) Nr. 1 VwVfG:
Die Behörde hat auf Antrag des Betroffenen über die Aufhebung oder Änderung eines unanfechtbaren Verwaltungsaktes zu entscheiden, wenn sich die dem Verwaltungsakt zugrunde liegende Sach- oder Rechtslage nachträglich zugunsten des Betroffenen geändert hat;
Und auch hier steht es (wie bei Radwegbenutzungspflichten oder Verkehrsverboten) im Ermessen der Behörde, diesem Antrag stattzugeben. Oder auch nicht. Eine besonders bittere Erkenntnis über unser Rechtssystem ergibt sich beispielsweise auch aus der Lektüre des § 183 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), denn auch Beschlüsse und Urteile der Verwaltungsgerichte, die auf einer für verfassungswidrig erklärten Regelung (wie einer Corona-Verordnung) aufbauen, bleiben in aller Regel rechtskräftig, lediglich der Vollzug wird gestoppt:
Hat das Verfassungsgericht eines Landes die Nichtigkeit von Landesrecht festgestellt oder Vorschriften des Landesrechts für nichtig erklärt, so bleiben vorbehaltlich einer besonderen gesetzlichen Regelung durch das Land die nicht mehr anfechtbaren Entscheidungen der Gerichte der Verwaltungsgerichtsbarkeit, die auf der für nichtig erklärten Norm beruhen, unberührt. Die Vollstreckung aus einer solchen Entscheidung ist unzulässig. § 767 der Zivilprozeßordnung gilt entsprechend.
Zur Verdeutlichung noch ein exemplarischer Auszug aus der Randnummer 5 des relativ aktuellen Beschlusses 9 B 26.20 des BVerwG vom 08.06.2021:
a) Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, der das Bundesverwaltungsgericht gefolgt ist, ist dem Grundgesetz keine allgemeine Verpflichtung der vollziehenden Gewalt zu entnehmen, rechts- oder verfassungswidrige belastende Verwaltungsakte unbeschadet des Eintritts ihrer Bestandskraft von Amts wegen oder auf Antrag des Adressaten aufzuheben. Dies gilt auch für bestandskräftige Verwaltungsakte, deren Rechtsgrundlage gegen Verfassungsrecht verstößt oder die auf der verfassungswidrigen Anwendung einer gültigen Rechtsnorm beruhen (…).
Die weiteren Ausführungen sind ebenfalls lesenswert, jedoch hinsichtlich eines evtl. noch vorhandenen Glaubens an einen „Rechtsstaat“ äußerst desillusionierend.
Halten wir fest: Bund, Länder und Gemeinden haben in den letzten 1,5 Jahren unzählige, zeitlich befristete, massiv in die Grundrechte einschneidende Verordnungen und Allgemeinverfügungen erlassen. Die Verwaltungsgerichte verweigern sich in den Eilverfahren 1,5 Jahre lang kategorisch jeglicher Kenntnisnahme der vorgebrachten sachlichen Einwände – und berufen sich stattdessen ausnahmslos auf das RKI und die (nirgends im Grundgesetz festgeschriebene) „Einschätzungsprärogative„. Der Bürger wird in der Folge mit teils enorm hohen Bußgeldern und ggf. sogar Freiheitsstrafen belastet, weil auch einzelne Amtsrichter sich in keinster Weise für sachliche Einwände interessieren. Und die wenigen Amtsrichter, die (wie in Weimar) anders entscheiden, erhalten dann eben eine Hausdurchsuchung; oder auch mehrere.
So erklärt ein Verwaltungs- oder Verfassungsgericht dann teils weit über ein Jahr nach dem fristgemäßen Auslaufen der jeweiligen Verordnung, dass jene Regelung verfassungswidrig war. Und dann sagt wiederum die Exekutive: „Ätschibätschi“, die Bestandskraft von Verwaltungsakten ist in diesem Unrechtsstaat bedeutsamer als die Tatsache, dass für die Regelung, gegen die du dich damals nicht effektiv zur Wehr setzen konntest, gar keine Rechtsgrundlage existierte! Weil dies ansonsten die „Rechtssicherheit“ und den „Rechtsfrieden“ gefährden würde.
Was das alles mit Artikel 19 (4) GG zu tun haben soll? Ich weiß es nicht. Wie gesagt; Deutschland war, vor allem auch aufgrund seines Rechtssystems, noch nie ein Rechtsstaat.

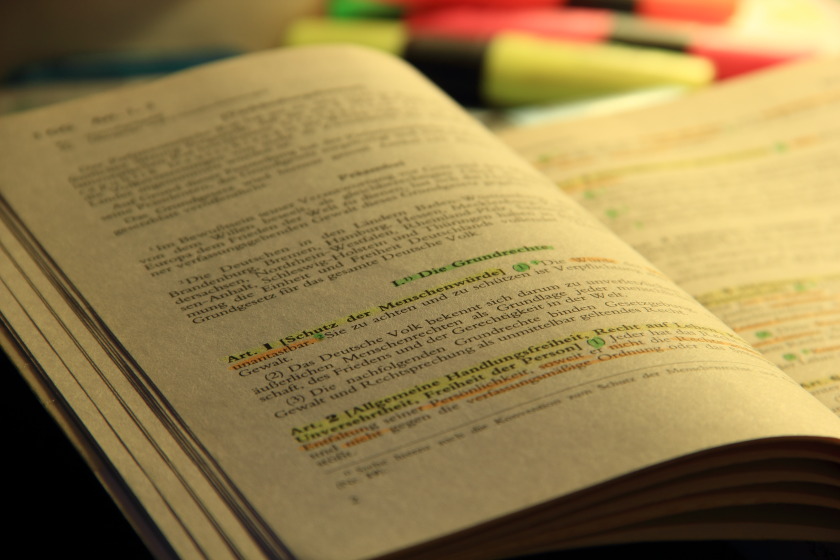
§ 44 Abs. 2 Nr. 6 VwVfG: Ein Verwaltungsakt, der gegen die guten Sitten verstößt, ist nichtig. Nichtige Verwaltungsakte sind nicht in der Welt, somit auch nicht zu befolgen.
Der Haken an der Sache: Abs. 6: Die Behörde kann die Nichtigkeit jederzeit von Amts wegen feststellen; auf Antrag ist sie festzustellen, wenn der Antragsteller hieran ein berechtigtes Interesse hat.
Natürlich kann es gar kein ‚berechtigtes‘ Interesse geben, denn die Ergebnisse stehen ja schon vorher fest: Gesundheitsschutz über alles.
„Gute Sitten“? Was ist das denn bitteschön für ein Schwurbelkram? 😉
Ich hab das übrigens sogar mal versucht, mit einem Nichtigkeitsfeststellungsantrag, auch wegen des regelmäßigen behördlichen Aufrufs, auf Versammlungen gegen das Vermummungsverbot zu verstoßen. Wurde mir nie beschieden.
Die Sache mit der Nichtbefolgung ist m. E. auch der einzig halbwegs erfolgsversprechende Weg; das heißt, die Sache irgendwie möglichst in die Länge ziehen, bspw. durch Leugnung des Zugangs der entsprechenden Bescheide. Ansonsten greifen halt die üblichen Wege des Verwaltungszwangs.